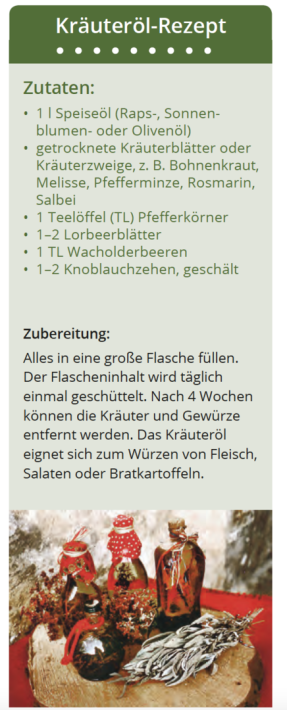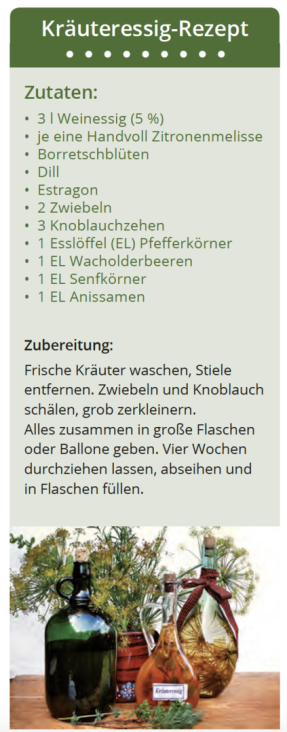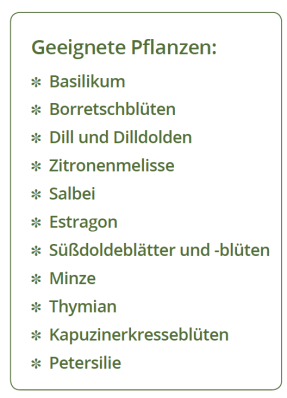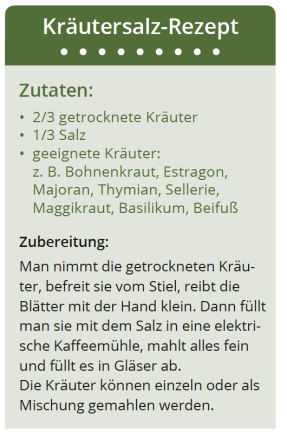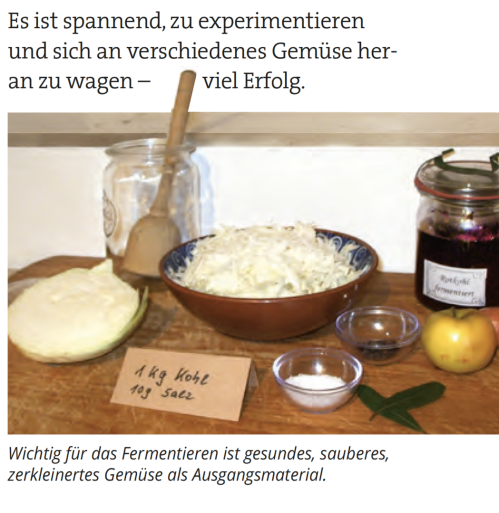Die Salatschüsseln sind auch geeignet
für Balkone, Terrassen und kleine Gärten.
Ebenso können Kräuter wie Schnittlauch,
Petersilie, Basilikum dazu gepfl anzt
werden. Kürbisse, Zucchini, Gurken und
Tomaten gedeihen in Kübeln, Töpfen
oder sogar in kleinen Zinkbadewannen
prächtig.
Bepflanzung der Gefäße
Und so werden die Gefäße vorbereitet:
Auf den Boden füllt man eine 5 cm dicke
Blähtonschicht, auch alte Ton- oder Ziegelscherben eignen sich. Die Schicht ist
eine Art Puff er, damit keine Staunässe
entsteht.
Wenn das Gefäßmaterial es zulässt, werden
einige Löcher in den Boden gebohrt.
Zum Befüllen eignet sich ein Gemisch
aus Gartenerde, Kompost und eventuell
grober Sand, dazu ein paar Hornspäne.
Nach der Salaternte bringt man die verbrauchte
Erde wieder im Garten aus und
bereitet eine neue Befüllung vor, die man
mit den nächsten Jungpfl anzen besetzt.
Mit 2–3 Schüsseln wird eine kleine Familie
den ganzen Sommer über mit frischem
Salat versorgt.
Nicht jeder hat einen Keller oder Dachboden
mit alten Schätzen, aber bei den
meisten Hobbygärtnern stehen überz.hlige
Pfl anzgefäße herum, die lassen sich
genauso nutzen, auch Flohmärkte bieten
manche Raritäten. Es ist gut, wenn alte
Sachen nicht einfach weggeschmissen
werden. Jeder dieser Gegenstände könnte
eine Geschichte erzählen, auch deshalb
sollte man sie lieber nutzen, bevor sie auf
der Müllhalde landen.
Besonders praktisch ist, dass man die bepfl
anzten Schüsseln und Töpfe auf eine
Schubkarre stellen kann und so gleichzeitig
ein „mobiles Hochbeet“ hat, das
man jederzeit an einen anderen Standort
fahren kann.
Großmutters alte Teigschüsseln, wie man
sie früher in jedem Haushalt vorfand,
eignen sich besonders für den Salatanbau.
Die Salatköpfe wachsen hier wie die
„Schwammerl“ und sind vor Schneckenfraß
geschützt.
Mit Gemüse bepflanzte Emailleschüsseln
und -töpfelassen sich auf Schubkarren als „mobile Hochbeete“ einsetzen.